| |
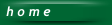 |
| |
|
| |
M
e n u e |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
 |
|

�ber alle Berge - Eine Bolivianische Zeitreise |
|
| |
|
|
Ohne den Einsatz
der Machete gibt es praktisch kein Durchkommen mehr. |
|
| |
Braulio
steckt im Dickicht, durch das wir uns den ganzen Tag durchwinden.
|
|
|
| |
In
zwei Stunden wird es dunkel und wir wissen nicht mehr genau, wo wir
sind. Das ist im Monte normal, alles sieht gleich aus. Jegliches Gefühl
für Raum und Zeit geht in dem grünen Dämmerlicht verloren,
in diesem Kosmos gibt es kein links oder rechts, gerade noch ein eingeschränktes
oben und unten. Alles um uns herum ist feucht, doch wir leiden Durst,
da es nirgends Trinkwasser gibt. Der Wald ist zum Verdursten trocken
- eine verdammte Wüste. Es wird bald dunkel sein, nirgends findet
sich ein auch nur annähernd ebener Platz, um die Zelte aufzustellen.
Eine Stunde später stecken wir immer noch im Gestrüpp, die
Macheten klingen und ab und zu flucht jemand, weil er sich endlich
ein Ende der Strapazen herbeisehnt. Hatten wir nicht heute morgen
noch eine herrliche Rundumsicht oben in Guinapi? Es kommt mir so vor,
als wäre das schon so lange her - ist es überhaupt wahr
gewesen, oder bilde ich mir das alles nur ein? Fünf Minuten bevor
es endgültig finster wird, stößt Paolino einen Freudenschrei
aus: Der Wald hat uns ausgespuckt! Auf der Lichtung ist viel Platz
für unsere Zelte und Paolino, der vor langer Zeit hier gewohnt
hat, weiß, wo es Wasser und saftige Aricumas gibt, rübenförmige
Wurzeln, die ähnlich wie Topinambur schmecken. Als ich in Gesellschaft
der Kameraden den ersten warmen Cocatee trinke, komme ich mir vor,
als wäre ich unendlich reich. |
| |
|
|
Sonnenstrahlen
dringen spärlich durch das dichte Blätterdach des Waldes. |
|
| |
Morgens
um sechs Uhr wecke ich die Anderen. Die Luft ist lau wie weiche Seide
und ein betörender Waldduft liegt in der Luft, eine eigenartige
Mischung aus Moder und Blütengerüchen - man wird ganz betrunken
davon. Zum Frühstück braten wir uns Pfannkuchen über
einem lustig züngelnden Feuer. Dann setzen wir uns in Bewegung.
Am Ende der Lichtung geht es durch steilen Wald abwärts. Die
Hitze schlägt auf uns ein wie eine Faust, wir sind schweißnaß.
Bei uns auf der Erde ist es dämmrig am hellichten Tag, wie ein
Vorhang fängt die himmelwärts strebende Vegetation einen
großen Teil des Lichts auf, um auf jedem Quadratzentimeter Platz
neues Leben zu produzieren. In diesem nie endenden, erbarmungslosen
Kampf ringen die Pflanzen stumm, verbissen und mit allen möglichen
Tricks gegeneinander. Es gibt keinen Ort, wo es deutlicher wird als
im Uwald, daß Leben und Tod Zwillingsbrüder sind. Am Nachmittag
überqueren wir den tosenden Rio Chajolpaya und messern uns einen
leidlich ebenen Zeltplatz frei. Danach schwärmen wir aus, um
zu fischen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: vier Kilogramm Fisch,
eine willkommene Ergänzung unseres Speisezettels. |
| |
Endlich
im >Nichts< angekommen, schlagen wir unser Zelt am Rand
des Flusses Chajolpaya auf.
|
|
|
| |
Fette
Beute: der Fang einer halben Stunde.
|
|
|
| |
In
der Nacht beginnen wir mit dem Frühstück: Kartoffeln und
Fisch. Während wir essen wird es ein klein wenig heller. Die
kühle Dämmerung ausnützend schlagen wir ohne lästiges
Gepäck einen Weg frei. Zur Begrüßung der Sonne hebt
ein betörendes Orchester an, ein Loblied auf die potentielle
Präsenz des Lebens, gesungen von den Kreaturen des Waldes. Für
die Dauer des Orchesters herrscht Waffenstillstand, keiner übertritt
das Gesetz, es ist in die Herzen der Waldbewohner eingebrannt mit
flammender Schrift und alle leben dem Gesetz nach. Hier gibt es keine
Gerichtsbarkeit - weil es kein Verbrechen gibt. Sobald die Sonne ihre
ersten Strahlen zur Erde schickt verstummt das Lebenslied der unsichtbaren
Kreaturen - die Raubtiere dürfen wieder Beute machen. |
| |
Teile
unserer Kleidung hängen bereits in Fetzen an unseren Körpern
und sind völlig verdreckt, was an diesen, ursprünglich einmal
weißen Hosen, zu erkennen ist.
|
|
|
| |
Andächtig
haben wir Menschenkinder die Macheten weggelegt, eine Weile innegehalten
und der Begrüßung des Morgens gelauscht. Niemand sagt etwas
in solchen Momenten - es ist auch nicht nötig. Der Wald pflanzt
einen verwunschenen Zauber in das Menschenherz, dessen Saat ganz langsam
aufgeht. Man betritt den Wald durch ein unsichtbares Tor und kommt
irgendwann wieder heraus. Dann ist die äußere Welt nicht
mehr dieselbe - weil du nicht mehr derselbe bist. Juan-Carlos ist
im Lager geblieben und bringt uns ein fertiges Mittagessen, unsere
Fährte war leicht zu finden: Wir hinterlassen einen Graben, der
sich wie eine tiefe Wunde durch den Monte zieht. Schon seit dem Vormittag
kündigt sich Regen an, Mücken sägen geräuschvoll
an der stillen Luft herum. Die nahen Bäume sind mit grauem Dunst
verhangen, weiter weg verlieren sie sich in den Eingeweiden der Wolken.
Plötzlich platzt der ganze Himmel auf, bekommt einen gigantisches
Riß von Pol zu Pol. Wasser tost brausend herab und überschwemmt
die Erde, alles fließt. Der Regen strömt herab wie eine
Glasscheibe, zerstiebt beim Aufprall in Scherben und Splitter, trommelt
mit 20 Fäusten auf meine Schultern. Innerhalb von Sekunden bin
ich so naß, als wäre ich durch einen Fluß geschwommen.
Was vorher Rinnsal war, ist jetzt reißender Strom. Eilig kehren
wir auf unserer Spur zum Lager zurück, um nicht durch neu entstehende
Flüsse von ihm abgeschnitten zu werden. Zurück bei den Zelten
machen wir uns unter einer überhängenden Felswand ein Feuer
und trocknen unsere Habseligkeiten, Paolino brennt sich dabei ein
Loch in die Hose. Wir sehen furchtbar abgerissen aus. |
| |
 |
 |

|
Letzte Aktualisierung: 18.01.06
|
|

